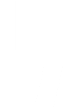Paraschat “Jitro“ פרשת יתרו
Auszug aus: “Studien zu den wöchentlichen Torah-Vorlesungen“, von Nechama Leibowitz
“Macht nicht mit Mir, Götter aus Silber und Götter aus Gold macht euch nicht“ (Schʻmot 20:20).
Dieser Vers wirft Fragen auf. Schließlich ist in den Versen 20: 3-5
3. „Du sollst keine fremde Götter haben vor Mir;
4. Du sollst dir kein Bild machen, kein Abbild des, was im Himmel droben und was auf
Erden hierunten und was im Wasser unter der Erde;
5. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen; denn Ich, der
Ewige, dein G-tt (bin) ein eifervoller G-tt, der die Schuld der Väter ahndet an Kindern,
am dritten und am vierten Gliede, die Mich hassen ...“
ausführlich das Verbot des Götzendienstes genannt. Doch wohl nicht bloße Wiederholung
oder Verstärkung des Gesagten wird hier Mosche unmittelbar nach der Übergabe der
Torah mitgeteilt. Und überdies erstaunt der Satzbau des Verses. Durch das in der Lesart
der Torah eingesetzte ʻEtnachtaʻ (Pausezeichen inmitten des Satzes) wird das
Satzfragment ʻMacht nicht mit Mirʻ von den ʻSilber-und Goldgötternʻ getrennt, und es kann
also nicht heißen: “Macht nicht Silbergötter mit Mir, und Götter aus Gold macht euch nicht“,
wie es ein konventioneller Satzbau hätte erwarten lassen.
Drei Erklärungen der Gelehrten werden dazu im Midrasch Mechilta zitiert: Rabbi
Jischmael erklärt, das Verbot beziehe sich auf die Abbildungen aller Arten von Engeln,
jener Kräfte, die “mit Gʻtt“ bzw. als Ausführende von dessen Absichten existieren. Rabbi
Nathan liest darin das Verbot, bildliche Entsprechungen für Gʻtt zu schaffen (wie nachher
etwa das Goldene Kalb). Rabbi Akiwa schließlich liest es als Warnung vor einer
Beziehung mit Gʻtt, der die Beziehung anderer Völker zu ihren Göttern gleicht. Diese
verehren die Götter, während es ihnen gutgeht, doch wenn sie Strafe und Unheil trifft,
zürnen sie den Göttern. Gʻtt jedoch ist (wie Rabbi Akiwa an König Davids Psalm 116 und
am Beispiel Ijows zeigt) im Leid ebenso wie in der Freude zu verehren, um so mehr, als
das Leid immer als Element der gʻttlichen Vergebung für die menschliche Sündhaftigkeit zu
verstehen ist. Alle drei Rabbinen gehen also auf die Objekte ʻGold-und Silbergötterʻ nicht
ein, sondern nur auf den Satzanfang vor dem ʻEtnachtaʻ. Auch liest keiner von ihnen den
Satz als Wiederholung des allgemeinen Götzendienstverbots.
Doch das Verständnis des “mit Mir“ (hebr.: itti) ist unterschiedlich. Für Rabbi
Jischmael bedeutet es “zusammen mit Mir“ (d.h. das Abbilden aller wirksamen Kräfte
Gʻttes), während für Rabbi Nathan das Abbilden Gʻttes selbst in irgendeiner Form hier
verboten wird. Rabbi Akiwa liest darum das Verbot, aus Gʻtt etwas ganz anderes zu
machen, bzw. die Beziehung Ihm gegenüber einer heidnischen Götterbeziehung
anzugleichen. Diese letzte Erklärung kann aus der historischen Situation verstanden
werden. Rabbi Akiwa lebte in einer Periode größter Repression durch das Römische
Reich, wo die Beschneidung ebenso wie das Torahlernen unter Todesstrafe verboten
waren. Deshalb ist für ihn das Wachrufen höchster Ergebenheit gegenüber Gʻtt auch in den
schwierigsten Verhältnissen zentral - auch wenn dieses in der konkreten Torahstelle, wo es
vorkommt, nicht in direkte Beziehung zu dem Davor- und Danachstehenden zu setzen ist.
In einer ganz anderen Zeit, im 15. Jahrhundert, als die Nachgeborenen des
Maimonides versuchten, einen möglichst praxisfernen Zugang zur Torah zu entwickeln,
nahm Rabbi Josef Albo in Spanien anhand unseres Verses gegen sie Stellung. Unter
Zitierung des vorhergehenden Satzes (“ihr saht, dass Ich vom Himmel mit euch sprach“),
erklärt er, Gʻtt sei weder zu fern, um zu Ihm zu gelangen oder sich auf Ihn zu beziehen,
noch durch notwendige Entsprechungen aus Gold oder Silber erdnah zu repräsentieren,
vielmehr hat Er selbst am Sinai direkt und unmittelbar zum Volk gesprochen, obwohl es mit
Ausnahme Mosche Rabbenus von seiner geistigen Verfassung her nicht dessen würdig
war.
Gerade umgekehrt wie Rabbi Albo hat im 20. Jahrhundert Umberto Cassuto diesen
Vers gelesen. In seiner Exegese sieht er im Verbot, Naturgewalten als Götter
nachzugestalten, ein epochenspezifisches relevantes Gebot. Zum gʻttlichen Gebot
Schʻmot 19:12, das Volk beim Sinai abzugrenzen, sieht Cassuto den Hinweis, das Volk
von der Illusion fernzuhalten, eine Verbindung des Menschen mit den Naturgewalten
schaffe auch eine Verbindung mit den Göttern. Was am Sinai geschieht, ist von Gʻtt allein
beherrscht. Er offenbart sich nicht in, sondern über der Natur, und das Volk bleibt davon
durch einen Zaun getrennt. Kein irdisches Material, auch nicht das von den Völkern als das
Wertvollste betrachtete, kann Gʻtt repräsentieren. Er bleibt über irdische Vor- und
Darstellung erhaben. Während also Rabbi Albo im Sprechen Gʻttes mit dem Volk “vom
Himmel“ das Überwinden der Distanz sieht, erblickt Cassuto gerade darin das Betonen
dieser Distanz. Nicht wie bei Albo die Unnötigkeit jeder “Vermittlung“ zwischen Irdischem
und Gʻttlichem ist für Cassuto also Grundlage des Abbildungsverbots, sondern die
Erhabenheit und unvorstellbare Größe Gʻttes.