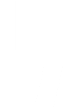Paraschat “Ki Tissa“ כי תשא
Auszug aus: Studien zu den wöchentlichen Torah-Vorlesungen, von Nechama Leibowitz
Mosches Abstieg vom Sinai
Vier Verse trennen Mosches Zwiegespräch mit Gʻtt auf dem Berg Sinai von dem Bericht über seine Ankunft im Lager, als er das Kalb erblickt. Die zwei ersten beschreiben die Bundestafeln: “Und Mosche wandte sich und stieg vom Berg hinunter, die beiden Bundestafeln in seiner Hand, Tafeln beschrieben von beiden Seiten, von der und von jener waren sie beschrieben. Die Tafeln, sie waren Gʻttes Werk, und die Schrift war Gʻttes Schrift, eingegraben auf die Tafeln“ (Schmot 32:15-16). Viele Erklärer haben sich schon darüber gewundert, dass diese beiden Verse nicht unmittelbar nach dem letzten Satz von Kapitel 31 stehen, wo von der Übergabe der gʻttlichen Tafeln an Mosche die Rede ist. Weshalb diese Verzögerung? Ein verzögert angebrachter Zusatz zu etwas schon Gesagtem ist in der Torah keine Seltenheit; im Talmud wird der Grundsatz, dass die Torah bei ihren Schilderungen nicht notwendig chronologisch vorgeht, ausdrücklich genannt. Doch soll man sich nicht auf diesen Grundsatz beschränken, ohne dessen Anwendung bei einer bestimmten Textstelle zu hinterfragen. Hier scheint es jedoch schwierig, die Bedeutung der Verzögerung auszumachen. Die Torah will die Heiligkeit der Bundestafeln gerade vor der Schilderung ihrer Zerstörung besonders hervorheben, um ermessen zu lassen, was dies bedeutet. Nachmanides betont, die beiden zitierten Verse stünden dort, “um zu sagen, dass Mosche durch all das nicht davon abgehalten wurde, sie zu zerbrechen“.
Die beiden folgenden Verse 17 und 18 schildern das Treffen Mosches und Jehoschuas während Mosches Abstieg, noch weit vom Volk entfernt. Von Vers 24:13 wissen wir schon, dass Jehoschua Mosche bis zu dessen Aufstieg zum Berg begleitet hat - und nun erfahren wir, dass er vierzig Tage dort ausgeharrt hat, um Mosche bei dessen Rückkehr zu erwarten, und nicht ins Lager zurückgekehrt ist. Die beiden Verse 17 und 18 enthalten ein seltsames kurzes Zwiegespräch zwischen Mosche und Jehoschua, das von Jehoschua eröffnet wird: “Jehoschua hörte die Stimme des Volkes in seinem Lärmen, und er sagte zu Mosche: ʻKriegesstimme ist im Lager.ʻ Und er sagt: ʻDa ist kein Stimmgesang der Stärke und kein Stimmgesang der Schwäche, Stimmgesang (Stimme eines Wettgesangs) höre ichʻ“. Abarbanel stellt in dieser Szene Jehoschua, der am Berg verharrt hat und nicht weiß, was im Lager geschieht, dem wissenden Mosche gegenüber, dem Gʻtt schon vor dem Abstieg vom Vergehen des goldenen Kalbs erzählt hat (32:7-10). Jehoschua vermutet also Kriegslärm, als Mosche schon weiß, welcher Art der Lärm ist.
Abarbanels Erklärung wirft jedoch Fragen auf. Natürlich weiß Mosche, nachdem er von Gʻtt unterrichtet ist, was im Lager geschieht, dass der von weitem gehörte Lärm einem Fest für das Goldene Kalb entstammt. Aber warum spricht er dann in Rätseln? Warum sagt er Jehoschua nicht gerade heraus, dass er sich bezüglich der Herkunft diese Lärms irre?
Nachmanides versucht auf diese Frage zu antworten, indem er die von Mosche benutzte Wendung “Stimmgesang höre ich“ der eigentlich kraft seines Wissens angebrachten Wendung “Stimmgesang ist es“ gegenüberstellt, die Mosche bewußt nicht gebrauche. “Mosche in seiner Bescheidenheit“, so Nachmanides, “erzählte Jehoschua nichts von dieser Sache, denn er wollte die Schande Israels nicht erzählen, sondern er sagte nur, es sei ausgelassener Lärm.“ Nachmanides Erklärung bringt das Verhalten Mosches in diesem Vers in Übereinstimmung mit seinem generellen Verhalten: Er versucht immer Israel zu verteidigen, nie richtet er seine Rede gegen sie, es sei denn, um sie zurechtzuweisen. Mosche mochte sich nicht vom Volk abtrennen, sondern dessen Los teilen.
Doch es gibt noch ein weiteres Verständnis der beiden Verse. Es ist die Meinung Rabbi Saadia Gaons, auf die Ibn Esra in seinem Kommentar zurückgreift. Ihr zufolge ist auch die Einleitung zu Vers 18, “und er sagte“, auf Jehoschua und nicht auf Mosche bezogen. Jehoschuas Rede wird im Text unterbrochen, um anzuzeigen, dass er eine Antwort von Mosche erwartet, doch als die nicht eintrifft, fährt er selbst fort, was eben durch das “und er sagte“ angezeigt wird. Dieser Erklärung zufolge beginnt Jehoschua mit seiner Befürchtung, ein feindliches Volk könnte ins Lager der Israeliten eingefallen sein. Er wartet auf Mosches Reaktion, doch dieser schweigt, und Jehoschua hört wieder auf den Lärm aus dem Lager und korrigiert seinen ersten Eindruck, dass es sich um Kriegslärm handle. Mosche reagiert wiederum nicht, weder bestätigend noch verneinend, er geht bitter und zornig weiter.
Vielleicht birgt diese Erklärung auch eine Antwort auf das oft und zuletzt von Rabbi Naftali Zwi Jehuda Berlin erwähnte Problem, die Verse 17 und 18 seien augenscheinlich für die Erzählung des goldenen Kalbes gar nicht von Belang. Warum also stehen sie geschrieben? Sie sind das letzte aufschiebende Moment, bevor die Erzählung zu ihrem Höhepunkt bzw. zu ihrem Tiefpunkt, Mosches Rückkehr ins Lager und die daraus entstehenden Konsequenzen, gelangt. Die Sätze stehen, um Mosches Schmerz, Aufregung und Zorn zu zeigen, die ihn der Sprache berauben. Wir sehen ihn gegenüber seinem Schüler, der vierzig Tage am Fuß des Berges auf ihn gewartet hat; Mosche wendet sich ihm nicht zu, antwortet ihm nicht, eingehüllt in Schweigen schreitet er dem entgegen, was vor ihm liegt ...